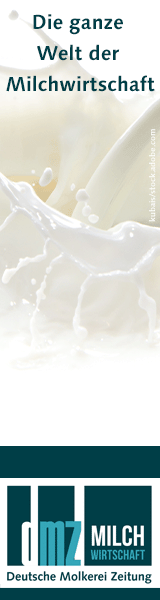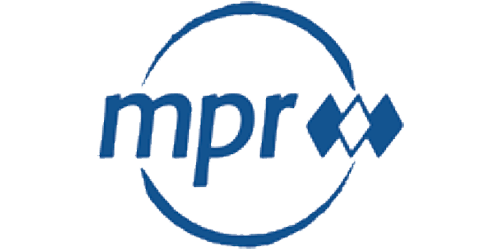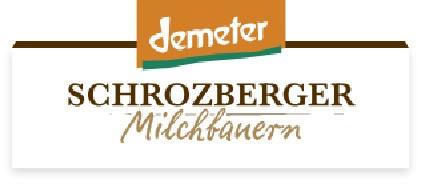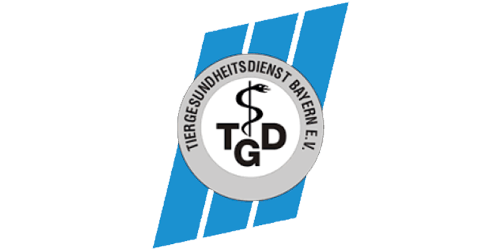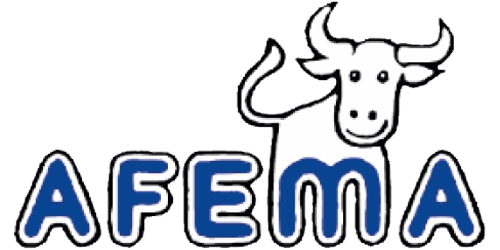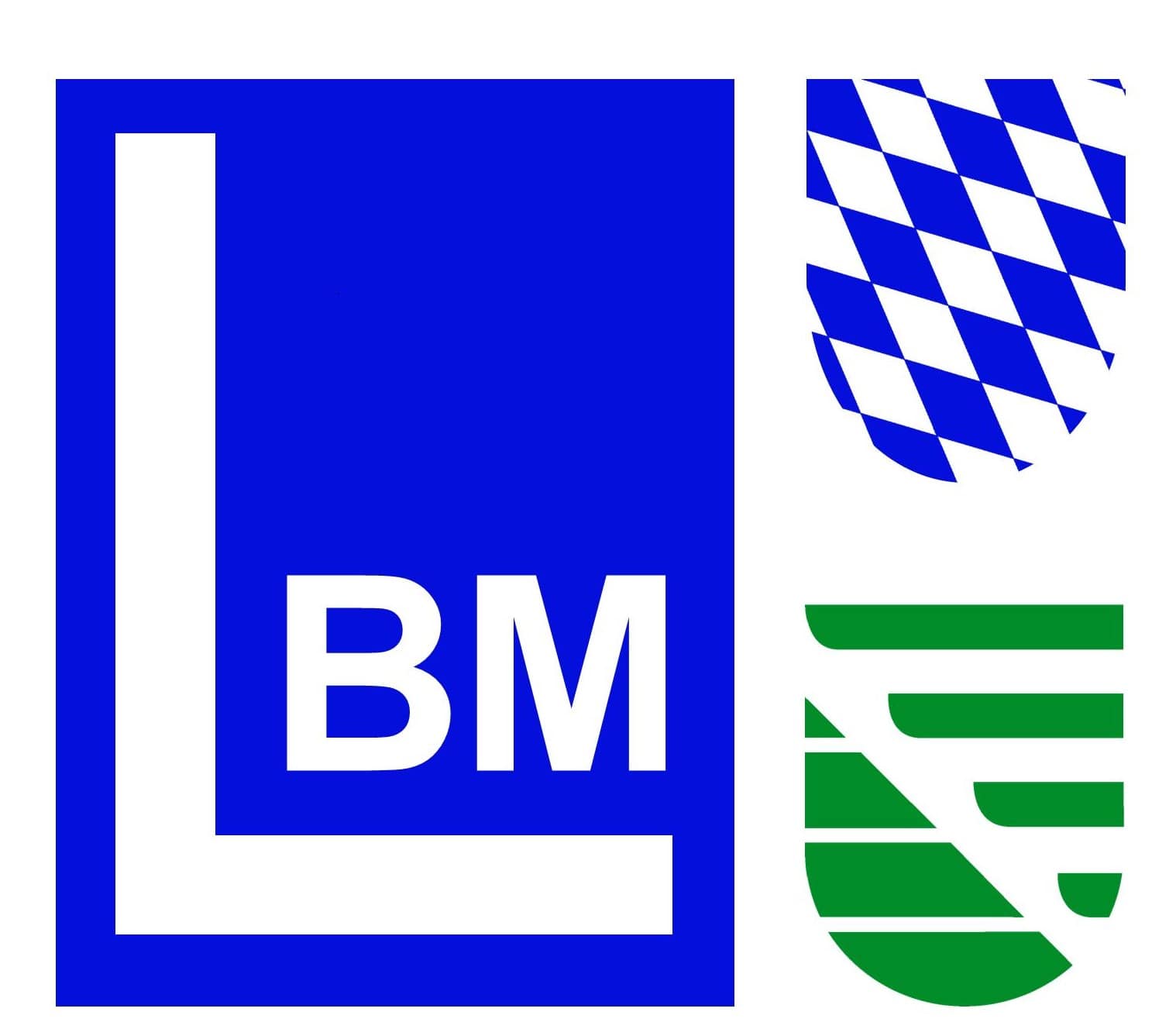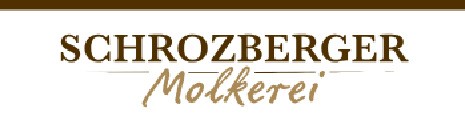Milchtagung der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft
Die vier „K“ Klima, Kennzeichnung, Krankheit und Kontrakte standen im Fokus der diesjährigen Milchtagung der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft (AbL), die Anfang März stattfand. Dabei zeigte sich deutlich, dass es von Seiten der Landwirte durchaus großen Gesprächsbedarf und starke Kritik bei Themen wie Tierhaltungskennzeichnung oder Milchmarktregulierung gibt.
Die Resonanz zur diesjährigen Milchtagung der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft (AbL) konnte sich sehen lassen Rund 40 Teilnehmer trafen sich Anfang März vor Ort in Hardehausen bei Paderborn, während weitere 50 Teilnehmer die Veranstaltung im Livestream verfolgten. Wie schon in früheren Jahren standen thematisch aktuelle Herausforderungen der Branche im Fokus. Diesmal lautete der Titel „Kuhhaltung im Karree: Klima, Kennzeichnung, Krankheit und Kontrakte“.
„Make the cow green again“
Zum Start in die Vortragsreihe begrüßte Moderator und Milchbauer Josef Jacobi den online zugeschalteten Prof. Dr. Andreas Gattinger von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Dieser gab einen Überblick über das Potenzial zirkulärer Tierhaltungssysteme für ein Agrar- und Ernährungssystem innerhalb der planetaren Grenzen. Er sieht im ökologischen Landbau den Impulsgeber für die Transformation von Landwirtschaft und Ernährung. Die Rolle der Kuh sei dabei schwierig. Einerseits habe sie eine besondere Bedeutung in der kulturellen Menschheitsgeschichte und auch kein Nahrungskonkurrent. Andererseits gilt sie für viele als „Klimakiller“. Die räumliche und zeitliche Entkoppelung von der pflanzlichen Landwirtschaft sowie die Verwendung von Wirtschaftsdünger erschweren die Situation weiter. So behauptet die Studie „Livestocks long shadows“, dass 18% der globalen Treibhausgasemissionen (THG) aus der Tierhaltung stammen. Insbesondere Rindfleisch schneide sehr schlecht ab, so Prof. Gattinger.
Doch es gibt aus seiner Sicht durchaus Lösungen für das Dilemma. Ein wesentlicher Aspekt ist die Weidehaltung. Bei dieser Variante entfallen viele der Quellen der THG-Emissionen von vorn herein. Die niederländische Universität Wageningen hat nachgewiesen, dass Graslandhaltung einen besseren CO2-Fußabdruck erbringt als Stallhaltung, obwohl die Milchmengen geringer sind. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Aufzuchtphase, die mit 24% einen besonders hohen Anteil an den THG-Emissionen besitzt. Daher müsse der Anteil der Aufzuchtphase durch eine deutlich längere Nutzungsdauer der Kühe verringert werden. Großes Potenzial habe auch die Nutzung von Leguminosen und Wirtschaftsdünger, da sie zu höheren Humusgehalten der Böden führt. Klimaneutralität zu erreichen sei dennoch sehr schwierig, so der Wissenschaftler. Aber die Reduktion sei schon sehr groß, wenn die Fleischrinder, anders als bisher, in die Bilanz der Betriebe einfließen würde.
Kontroverse Tierhaltungskennzeichnung
War nach diesem Vortragsblock der Diskussionsdarf noch relativ gering, sollte sich das in der Folge deutlich ändern. Robert Römer, Geschäftsführer der Initiative Tierwohl, gab den Teilnehmern via Livestream einen Überblick über die ersten zehn Jahre der Initiative. Bei dieser handelt es sich um ein Förderprogramm für Tierwohl mit Partnern aus allen Bereichen der Lebensmittelkette. Sie unterstützt Landwirte finanziell bei ihren Bemühungen über den gesetzlichen Standard hinausgehende Maßnahmen zum Wohl ihrer Nutztiere umzusetzen. Römer ging dabei vor allem auf das Produktsiegel ein. Dieses habe sich nach und nach entwickelt und den Landwirten im letzten Jahrzehnt rund 1,5 Mio. Euro Zusatzeinkommen beschert. Problematisch sei aber eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung, die zu bürokratischem Mehraufwand führe. Daher forderte er von der neuen Bundesregierung eine grundlegende Reformierung des Gesetzes und eine Aussetzung der geplanten Einführung zum August 2025. Damit stieß Römer auf starken Widerspruch aus Reihen des Auditoriums. So sah ein Teilnehmer die Aussetzung äußerst kritisch. Er sehe keine Probleme bei einer solchen, entgegnete Römer. Es sei sinnvoller erst zu überarbeiten und dann umzusetzen. Alles andere ende in einer Katastrophe. Das sah der Bundesgeschäftsführer des AbL, Bernd Schmitz, allerdings ganz anders. „Wir fordern, dass das staatliche Tierhaltungskennzeichnungsgesetz bleibt und weiterentwickelt wird. Nur so kann Verlässlichkeit für die Betriebe und Verbraucher sichergestellt werden. Außerdem ist die langfristige Finanzierung nach den Borchert-Plänen umzusetzen und etwa die Anhebung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte um 2-3 Prozent ein guter Einstieg.“
Zudem monierte er die Aufnahme des Laufstalls und der Weidehaltung in die Haltungsform Bio als zu viel und nicht umsetzbar. Auch hier widersprach Römer. Der Laufstall werde bei der Bio-Stufe keine Rolle spielen, sondern nur bei konventioneller Haltung.
ra
Den ausführlichen Nachbericht finden Sie in einer der kommenden Ausgaben der Allgäuer Bauernblattes und der Deutschen Molkerei Zeitung